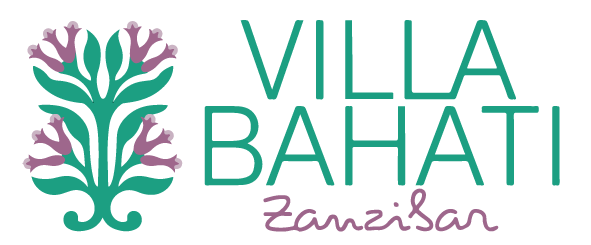- +255 748 235 949
- +43 664 248 0505
Halleluja und Kili – die beachboys von Sansibar
Eine Postkarte aus Ostafrika von Karin Ivancsics
Halleluja, Hote, Samson und Simba. Oder Kili wie das local beer – Abkürzung für Kilimanjaro. Oder Peter und Patrick, Samuel und Moses. So nennen sich die Gastarbeiter vom Festland Tansanias, ihre Massai-Namen sind zu schwierig nachzusprechen für Touristen. Kosei Kovu Daudi zum Beispiel. Ihn traf ich bei meinem ersten Mal auf der Insel, vor sieben Jahren. Damals war er als Verkäufer von Schmuck, den die Frauen in seinem Dorf fertigen, auf den puderzuckrigen weißen Stränden Sansibars unterwegs. Wie zeit-/ortversetzt wirken die hoch gewachsenen, schlanken dunklen Gestalten mit bunten Umhängen, Schwertern und Stöcken; sie tragen lange Ohrringe, mehrere Halsketten und Perlenbänder um Fuß- und Handgelenke; ihre Sandalen sind aus alten LKW-Reifen gemacht. Bei Ebbe und sengender Sonne könnte man im Gegenlicht meinen, sie durchquerten eine ausgetrocknete Steppenlandschaft. Ihr Stolz prägt nicht nur ihren Gang, er ist ihnen ins Gesicht geschrieben, vor allem die Profile junger Männer mit ihrem kunstvoll geflochtenen Haar stechen hervor. Sie stehen vor dir, halbnackt, und sind, wer sie sind: Halleluja oder Kili. „Jambo”, „mambo”, „poa” – „nice to meet you”.
Strandverkäufer treten weltweit ähnlich auf und haben den Ruf, hartnäckig und furchtbar lästig zu sein. Das trifft auf die beachboys in Sansibar nur selten zu, ihre besondere Wesensart ist es, die auf mich keineswegs aufdringlich wirkt. Manchmal zeigten sie mir ihre Ware, breiteten auf einem Tuch Ketten, Reifen und Ringe, geschnitzte Masken und Figuren aus, manchmal ließen sie sie auch in der Tasche, wenn ich, asante sana, abgelehnt hatte, und setzten sich einfach so neben mich. Was ich anfangs als befremdlich wahrnahm, dieses nebeneinander Sitzen und Sein von zwei Fremden, die auf das Meer schauten und gemeinsam Ebbe und Flut beobachteten ohne viel zu sprechen, wurde mir mit der Zeit immer vertrauter. Der Austausch funktionierte über Gesten, körperliche Signale und durch die Konzentration auf Schwingungen. Ich ließ mich darauf ein und erkannte die Stimmen meiner Gegenüber als wichtigste Barometer für gelingende Kommunikation – die Bedeutung der Worte trat in den Hintergrund -, es waren Berührungen, die mir unmittelbar in den Körper fuhren, ähnlich wie Musik.
Wie sich manche mzungus gegenüber den Massai verhielten, empfand ich jedoch als beschämend. Mehrmals musste ich beobachten, wie unhöflich sie diese behandelten: „No, damn, leave us!“ Wie von Sinnen brüllten von der Sonne verbrannte Europäerinnen die friedfertigen jungen Männer an, „Leave! NOW! GO!“, und verjagten sie wie streunende Hunde. Es mochte ja sein, dass sie bei früheren Reisen auf sekkante Verkäufer gestoßen waren, auch ich hatte v. a. in nordafrikanischen Ländern unangenehme Erfahrungen gemacht, aber deswegen musste man nicht – bevor die betroffene Person eine Chance gehabt hatte sich zu äußern – dermaßen aggressiv reagieren. Einmal fragte ich Kosei, was er davon halte, er antwortete: „Their energy is confused. Too much stress, you know. Sometimes it gets better, when they spend time here with us …“ Zum Glück sind nicht alle Urlaubsgäste so. Die ruhige Art der Massai ist es, die gut ankommt, und ihr Äußeres: Es eignet sich vorzüglich für ein Selfie, für das man gerne ein paar Shilling oder Dollar locker macht – was junge Tansanier vom Festland dazu veranlasst, sich ein wenig zu verkleiden, um ihr eigenes business anzukurbeln, Umhang, Schwert und Schmuck: fertig ist der „Plastikmassai“, wie er von Einheimischen und Hotelbetreibern genannt wird. Für Kenner entlarvt er sich durch zu dicke Waden und unzureichenden Körperschmuck, fehlende ausgedehnte Ohrläppchen oder intakte untere Zahnreihen – in einigen Clans wird den Männern einer der mittleren unteren Schneidezähne gezogen.
In unseren Gesprächen wollte ich viel von ihnen wissen und sie gaben bereitwillig Auskunft. Kosei zeichnete mir die Lage seines Dorfes in den Sand, ich kannte Bilder der Hütten aus Dokumentarfilmen: sie sind aus getrocknetem Kuhdung, Lehm und Holzpfosten, in denen auch Kleintiere schlafen. Darin brennt ständig ein kleines Feuer, das zum Kochen dient sowie Moskitos und anderes Ungeziefer fernhalten soll, abends sorgt es für Wärme. Außer durch ein winziges Loch fällt kein Tageslicht in den Raum, Stühle, Tische oder Wandschmuck gibt es nicht, geschlafen wird auf Rinderfellen. Als Hirtenvolk ist der Besitz von Kühen ihr wichtigstes Statussymbol und mit entsprechend viel Prestige verbunden; die Massai kennen alle Kräuter, die ihren Tieren (und ihnen selbst) bei Krankheiten helfen. Bei langanhaltender Trockenheit fürchten sie Dezimierungen der Herden, was sie tatsächlich vor große Überlebensprobleme stellt. Sie glauben, durch den Verzehr der Viehprodukte im Einklang mit ihrem Gott zu leben. Wie mir Kosei erzählte, ernährten sich einige Stämme früher fast ausschließlich davon, mittlerweile ergänzen Reis, Mais, Gemüse, Fladenbrot und Eier den Speiseplan. Einmal wöchentlich zapfen sie heute noch Blut von ihren Rindern, vermischen es mit Milch und die ganze Gemeinschaft darf von dem stärkenden „Lebenssaft“ trinken. Sie nutzen alle Tierbestandteile, nicht Essbares wird zu Werkzeugen verarbeitet, Felle dienen als Kleidung, Wasserbehälter oder Bettauflagen. Nach ihrem Glauben war es Engai, ihr Naturgott, der ihnen die Rinder als Geschenk überließ – er lebt auf dem Gipfel des Ol Doinyo Lengai, einem aktiven Vulkan im Norden Tansanias. Viele Massai reisen dorthin, um zu beten oder Opfer darzubringen. Ich befragte sie auch über Initiationsriten, Kosei schrieb mir alle wichtigen Begriffe mit penibler Handschrift in mein Notizbuch: laiboni (traditioneller Medizinmann), emoratta (Beschneidungs-Zeremonie), die Bezeichnungen der Hirten und Krieger: layoni, moran, meshuki …, ab wann ein Mann heiraten darf und wieviel der Brautpreis beträgt (25 – 30 Rinder). Wir sprachen auch über Genitalbeschneidung bei Frauen, die offiziell verboten ist und bei manchen Stämmen dennoch durchgeführt wird – ein Tabu. Immerhin: ich teilte ihnen meine Empörung darüber mit und sie hörten mir zu.
Die Mehrheit der Massai kommt aus der Nähe des Kilimanjaro (Kwaruda, Kisinda, Kwediboma), aus Arusha, Moshi oder vom Lake Eyasi. Einst reichte ihr Land vom Rift Valley, einem Teilstück des ostafrikanischen Grabens in Kenia, bis tief nach Tansania hinein, an die Kitwai Plain im Süden; Moshi im Osten und die Serengeti im Westen begrenzten das Gebiet. Die tansanische Regierung verkauft weiterhin Land an Privatinvestoren und drängt die Massai dadurch in entlegene Regionen, die für ihre Kühe nicht genug Weideplätze bieten, der Straßenbau tut das Übrige, um ihr Terrain zu zerstückeln. Die Gemeinschaft des stolzen Halbnomadenvolkes gerät in Gefahr sich aufzulösen und ihr Gesellschaftssystem gerät aus den Fugen. Deren Lebensweise passt längst nicht mehr in unsere Welt, und so vegetieren mehr und mehr Clans im Zustand der Entwurzelung dahin oder lassen sich als Gegenleistung für Hilfsmaßnahmen bekehren. Peter, Patrick, Samuel und Moses können also auch ihre richtigen Namen sein, auf die sie getauft wurden. Immer mehr Mitglieder im Schutzgebiet bekennen sich zum Christentum, sie nehmen es jedoch locker, die Diskrepanz zwischen neuem Glauben und althergebrachter Lebensweise zeigt sich u.a. darin, dass Männern nach wie vor zugestanden wird, so viele Frauen zu heiraten wie es ihnen ihr Rinderreichtum ermöglicht – hakuna matata.
Der Gemeinschaftsgedanke ist tatsächlich das zentrale Element ihres Zusammenlebens, fand ich heraus, Selbstbereicherung ist ihnen fremd. Das heißt, es wird nicht akzeptiert beziehungsweise kommt praktisch nicht vor, dass jemand seine soziale Stellung durch harte Arbeit verbessern kann: es existieren keine Aufstiegsmöglichkeiten, Emporkömmlinge wie bei uns im Westen gibt es nicht! Soziales Leben, Status und Aufgaben werden ausschließlich durch die Altersklasse bestimmt: „Es ist nicht notwendig, die Laterne eines anderen auszublasen, damit die eigene heller scheine.“ (Bantu-Sprichwort) Während die Jüngeren sich vorrangig um die Pflege des Viehs kümmern, später um Familie und Clan, haben die Stammesältesten aufgrund ihrer Lebenserfahrung bei Entscheidungen das letzte Wort. „Kuishi mengi kunamaanisha kuona mengi.“ – Viel leben heißt viel sehen. Was harmonisch klingen mag, hat naturgemäß Nachteile: Die Alten bestimmen, was häufig mit dem Festhalten an überkommenen Traditionen einhergeht und es den Jungen schwer macht, ihre Interessen durchzusetzen. Wenn ich an all die abgeschobenen Alten in unseren europäischen Heimen denke und wie sehr sie von der Gesellschaft und ihren Familien als Last angesehen werden, zweifle ich allerdings an unserem ach so „fortschrittlichen“ System.
In Lesoit, dem Dorf, aus dem Kosei stammt, half eine evangelische Kirche aus Deutschland mit Regenwassertanks, Schulen und Solaranlagen und trug wesentlich dazu bei, dass die meisten der ehemaligen Großviehnomaden sesshaft wurden. Unter Anleitung begannen sie Ställe für ihre Kühe zu bauen und Hochgras anzupflanzen, um daraus Heu zu machen. Da ihre Weideplätze immer eingeschränkter werden, eine Maßnahme, die überlebenswichtig sein mag – fraglich sind die Methoden trotzdem. Ich habe mir Videos von amerikanischen Freikirchen angesehen, die Massai-Dörfer geradezu „kaperten“, um mit der Errichtung eines Brunnens quasi in einem „Aufwaschen“ gleich alle Bewohner zu taufen – man könnte meinen, es hätte sich seit den finsteren Zeiten der weitläufigen Missionierungen durch Kolonialmächte nichts am „Menschenfang“ und der Rettung so genannter „zurückgebliebener indigener Völker“ geändert? Und dennoch: es ist etwas im Wandel, es ist nicht aufzuhalten. Es sind die Jungen, die als watchmen oder beachboys auf die Insel kommen, die meisten von ihnen haben basic english in der Schule gelernt, sie sind wissbegierig und clever, lernen unterschiedliche Sprachen, Nationalitäten und Kulturen von den tourists und dadurch eine Menge von der Welt kennen, ohne jemals das Land verlassen zu haben. Und sie wissen neue Technologien wie Internet und Handys zu nutzen. Das ist spannend.
Bei meinem letzten Insel-Aufenthalt traf ich Peter Kisinida Fiega, ein getaufter Christ aus Ngorongoro. Da ich zwei Monate vor meiner Reise in einem Kurzbericht im Fernsehen über die drohende Vertreibung von Massai-Stämmen in diesem Gebiet erfahren hatte, fragte ich ihn nach dem neuesten Stand. Er erzählte, dass sich die tansanische Regierung nach wie vor weigere zuzugeben, dass Menschen – auch mit Gewalt – gezwungen würden, ihre Heimat zu verlassen. Offiziell argumentierten Beamte damit, dass das fragliche Areal von den Massai und ihrem Vieh überbevölkert sei und dass dies eine Gefahr für die Umwelt darstelle – alles Ausreden, meinte Peter. Das Ngorongoro-Naturschutzgebiet ist seit 1979 Weltnaturerbe; über 100.000 Massai wären von einer Umsiedelung betroffen. Der tansanischen Regierung ginge es nicht um den Schutz der Natur, sondern um den Tourismus, der eine immer wichtiger werdende Einnahmequelle für den Staat darstelle. Er erzählte weiter, dass einige Familien bereits ausgesiedelt wurden und dass man nun Ausflüge zu den Reservaten buchen könne, die guided tours brächten gutes Geld – nachdem die mzungus auf Safaris Elefanten, Löwen und Gazellen besichtigt haben, besuchen sie im Anschluss ein authentic Massai-Dorf: die Daheimgebliebenen werden über die Fotos staunen! Das größere Geld werde aber noch verdient werden, ergänzte er, im Norden soll es weitere Aussiedlungen geben, dahinter stecke die berüchtigte Otterlo Business Corporation (OBC) – ein Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das luxuriöse Jagdausflüge für königliche Familien und Superreiche organisiert. Als Peter erfuhr, dass ich Schriftstellerin bin, bat er mich eindrücklich, meinen Leuten in Europa von dieser Ungerechtigkeit zu berichten: „Tell them, it is the land of our ancestors, we can’t just leave!” Meinen Einwand, dass ich zu unbedeutend sei, ließ er nicht gelten: „Everything and everyone is equally important in our cosmos – plant, animal, human (in dieser Reihenfolge) – please try.“ Bittesehr. Asante sana watu wajanja wa ajabu.
Erschienen in „Literatur und Kritik“, Salzburg, Mai 2023, Copyright: Karin Ivancsics
Karin Ivancsics lebt als Schriftstellerin in Wien, im Burgenland und auf Reisen. Sie schreibt Erzählungen, Romane, Theaterstücke und Essays und erhielt dafür mehrere Auszeichnungen, u.a. Aufenthaltsstipendium des Senats im Literarischen Colloquium Berlin, Hertha Kräftner-Preis, Österreichisches Staatsstipendium, Kulturpreis für Literatur des Landes Burgenland 2022. Buchveröffentlichungen zuletzt: „Aufzeichnungen einer Blumendiebin“, Klever Verlag (2021), „Zugvögel sind wir“, edition lex liszt 12 (2022). Mitglied von Podium und Grazer Autorinnen Autorenversammlung, Präsidiumsmitglied der Erich Fried-Gesellschaft. www.karinivancsics.at